Weltherrschaft, überdimensionierte Bösewichte und Gadgets, ironische Oneliner: Bond-Klischees, die sich längst von den Filmen gelöst haben. Doch kaum einer kennt denjenigen, der diese Klischees in seinen Filmen maßgeblich schuf: Lewis Gilbert, der jetzt im biblischen Alter von 97 Jahren gestorben ist. Eine Huldigung an einen Bond-Träumer, der nicht nur Kindern das Staunen lehrte.
Über die Frage, welchen kreativen Spielraum die Regisseure prinzipiell in einem Multi-Millionengeschäft wie der Bond-Serie haben, lässt sich gut streiten. Über ihnen schweben immer die Geldgeber und im operativen Geschäft konkret die Produzentenfamilie Broccoli, die über ihr Kind wacht und immer das letzte Wort hat. Einen Director’s Cut gab es bei Bond nie. Und wird es wohl auch nicht geben.
Und doch prägten die Regisseure die Bondfilme in der Regel mehr, als die breite Öffentlichkeit im Allgemeinen glaubt. Denn sind auch viele Bond-Filme formelhaft strukturiert, so unterscheiden sich die Filme bei genauer Betrachtung doch ziemlich. Sie unterschieden sich wie die jeweiligen Macher auf den Regiestühlen, bisher immerhin 11 an der Zahl.
Da wären etwa die ganz alten Terence-Young-Filme, Dr. No, Liebesgrüße aus Moskau oder Feuerball, die James Bond als Figur noch am ehesten ernst nahmen und wenn man übertreiben will tatsächlich einen Agenten bei der geheimdienstlichen Arbeit zeigten; dann gibt es die auch recht alten Guy-Hamilton-Filme wie Goldfinger oder Diamantenfieber, die sarkastisch die Bond-Figur überzeichneten und Prototypen eines Blockbusters wurden, oder eben die ganz aktuellen Sam-Mendes-Filme wie vor allem Skyfall, die Bond mit dem kernigen, nicht eigentlich hübschen und bewusst schnöselfreien Daniel Craig wieder zu einer feuilletonkompatiblen Zeitgeist-Adaption machten.
Lewis Gilbert bei der Arbeit am Set von You only live twice
Gilbert schuf wesentlich das Bond-Klischee mit
Und dann gibt es eben die drei auch recht alten Lewis-Gilbert-Filme, die die Figur auf eine märchenhafte Metaebene hoben und in der Gesamtwirkung von Plot, Schauspieler und Inszenierung dem Geschehen durchgehend einen surrealen, stark ästhetisierten und symbolischen Zug verliehen. Es war seine Filme: Man lebt nur zweimal (1967), Der Spion, der mich liebte (1977) und „Moonraker“ (1979), die im gesellschaftlichen Langzeitgedächtnis besonders haften geblieben sind. Nicht weil sich die meisten an die genaue Handlung erinnern könnten, sondern weil sie, wie vielleicht sonst nur „Goldfinger“, am meisten für die Allgemeinheit die klassische Vorstellung davon prägten, wie ein Bondfilm aussieht.
Da ein größenwahnsinniger Oberschurke, der die Welt vernichten wollte, dort ein Bond, der als britischer Gentleman makellos angezogen ist, allerlei technisches Schnickschnack mit sich trug, und immer mit einem coolen Onliner auf der Lippe seine Gegner ins Jenseits beförderte und der dabei nebenbei noch diverse Schönheiten verführen konnte. „I hope you enjoyed the show“, sagte Roger Moore in Der Spion, der mich liebte zu seiner hübschen Begleiterin und brachte damit den Sinn ihrer gemeinsamen Filme Ende der Siebziger auf den Punkt.
Mit Roger Moore fand Lewis Gilbert einen kongenialen Partner, der mit ihm die gleiche Vorstellung von Humor und auch ein kindliches Gemüt teilte. Die Gilbert-Filme nahmen Bond nicht ernst. Wie soll man einen Geheimagenten ernst nehmen, der jedem seinen Namen aufdrückt und jeder auf der Welt kennt, pflegte Gilbert in diesem Zusammenhang zu sagen. Für Gilbert war die Figur die auf der ganzen Welt verstandene Chiffre für den Traum von einem Fantasie-Helden, der das Böse besiegt und dabei keinem wehtun muss.
Die Filme sollten Spaß machen und nicht zu tiefgründig sein, darin waren sich Lewis Gilbert und Roger More einig. Wenn auch Bond-Puristen über die endgültige Comicisierung der literarischen Fleming-Figur stöhnten – seine Bond-Filme waren manchmal lustig, manchmal atemberaubend, fast immer spektakulär und episch inszeniert. In Sachen Optik und Musik setzten seine Filme zweifellos Bond-Maßstäbe. Und sie rührten an. Roger Moore schwärmte einmal von der „ungeheuren Fähigkeit“ von Lewis Gilbert, „einer Szene Komik und Drama zu verleihen. Er erkannte in allem die Wahrheit und hat dabei einen Sinn fürs Groteske.“ Und Bond war für Gilbert etwas Groteskes, und so inszenierte er seine Bonds auch. Bigger than life. Verzerrt, entrückt, artifiziell.
Lewis Gilbert 2012 über seine Fußball-Leidenschaft
In der eigenen Filmwelt
Gilbert tauchte bei einem Dreh absolut in seine eigene Fantasiewelt ein, wie Kollegen immer wieder feststellten. Er galt als exzentrisch, als Einer, der immer ein bisschen verwirrt erschien und auf dem Set in erster Linie nur den eigenen Film im Kopf hatte. Das konnte für die Crew schon einmal teuer werden. So wurde bei dem Dreh in Japan von Man lebt nur zweimal ein Mitarbeiter nur dafür abgestellt, dem Regisseur zu sagen, wann wo die Schuhe auszuziehen sind. Auch sich selbst schonte Gilbert in keiner Weise, wie Roger Moore in seiner Autobiografie zum Besten gab:
„Wie ich bald feststellte, konnte sich Lewis so sehr auf eine Szene konzentrieren, dass er von dem, was um ihn herum geschah, nichts mitbekam. Eine Szene drehten wir auf zwei Podesten, und Lewis war so auf seine Arbeit fixiert, dass er vergaß, wo er war: Als er einen Schritt zur Seite machte, fiel er zwischen die beiden Podien und stürzte vier Meter tief zu Boden. Unten angekommen, rappelte er sich wieder auf und setzte die Arbeit fort.“
Die Show musste schließlich weitergehen.
Zirkus-Kind und Zirkus-Bond
Gilberts Bonds machen noch heute besonders auf Kinderaugen Eindruck. Sie gleichen in ihrer opulenten Revuehaftigkeit oft auch einem Zirkus. Das Motiv des Zirkus findet sich nicht zufällig am Ende des Abspanns seines größten Publikumhits Moonraker. Was viele nicht wissen, ist der persönliche Hintergrund dieser Herangehensweise. Gilbert ist selbst als Kind in einer Zirkusfamilie aufgewachsen, die nicht viel Geld hatte. Seine Familie musste oft von der Hand in den Mund leben; sein Großvater war in den 1880er-Jahren vor den antisemitischen Pogromen völlig mittellos nach England geflohen. Gilbert junior war als kleiner Music-Hall-Entertainer von Anfang an auf der Bühne dabei, und verstand so früh das Spiel von Lacher und Applaus. Nach dem frühen Tod seines Vaters war er oft ganz allein und entfloh der Realität in Fantasieträume. In seinen Memoiren schrieb er über seine ersten Lebenseindrücke:
„ I was born on the 6th of March, 1920, in a trunk. By the time I was four years old there was little about variety I didn’t know because every night I would stand in the wings and watch the different acts. The knockabout ones I loved, and when they were throwing flour over each other you could not move me from the side oft he stage. (…) The patter acts and uick-fir stand-up comedy I didn’t really understand, but I was still interested because I knew where the laughs came. I’d look out at the audience and wait and think. “This is it. Laugh,” and they did. They all laughed. That feeling of knowing more than audience was wonderful. However, as I stood there every night I was filled with experiences not only wonderful but also strange. Still, they exercised my imagination.”
Als achtjähriges Kind war Gilbert fasziniert von Westernfilmen, die er bis zu zweimal am Tag ansah. Schauspiel und Realität waren für Gibert kaum zu unterscheiden.
“Why would an actor – and I knew that actors appeared in films because I had already been in a couple myself – why would an actor playing a cowboy or an Indian allow himself to be killed? Why would he let someone fire a gun at him or shoot an arrow through him? I couldn’t understand that at all but I didn’t want to ask. […] There it was again, the inability of the child thrown into a world fantasy to adjust to what was fantasy and what was fact.“
Eigentlich wollte Lewis Gilbert immer Fußballer werden – Arsenal London, der in den 1930er-Jahren von Erfolg zu Erfolg eilte, war von Wiege bis zur Bahre sein Verein. Mit Sean Connery, mit dem er 1967 in Man lebt nur zweimal arbeitete, soll sich Gilbert stundenlang vor allem über Fußball unterhalten haben, wohl auch, weil Connery zu diesem Zeitpunkt nichts mehr hasste, als über Bond zu reden.
Ein Bond-Fan weist die besondere Lewis-Gilbert-Bond-Formel nach
Die Filmanfänge im Krieg
Aber Gilberts Zukunft lag von Anfang an beim Film. Dort wurde er in jeder Beziehung sozialisiert. Als Kinderstar stand er bis ins Alter von 17 Jahren regelmäßig vor der Kamera. Bei ersten Gehversuchen als Helfer hinter der Kamera lernte er das Filmhandwerk dann von der Macherseite kennen. Der Film war auch seine Rettung, als er nach Kriegsbeginn zur Royal Airforce eingezogen wurde. Als Dokumentarfilmer im Auftrag der RAF wurde er zum Regisseur ausgebildet. Und der Krieg ließ ihn auch nach dem Krieg nicht los. Seinen ersten, preisgekrönten Erfolg erzielt er 1956 mit Reach for the sky ( Allen Gewalten zum Trotz), einem Film, der die Geschichte eines verwundeten RAF-Fliegers erzählte, manche würden auch sagen, glorifizierte. Mit Kriegsepen wie Sink the Bismarck wurde er vor allem in England bekannt. Seinen kommerziellen Durchbruch erreichte er 1966 mit dem Smash-Hit Alfie, ein Film über einen launigen Frauenheld in den Swinging Sixties, der sich nicht auf eine Frau festlegen wollte und sich schließlich in seinen Beziehungsgeflechten verhedderte. Hauptdarsteller Michael Caine wurde durch den Film zu einem Weltstar. Gilbert und Caine blieben eng verbunden.
„One life for your dreams“
Und Gilbert bekam nach Alfie den Anruf von Bond-Produzent Cubby Broccoli, der fragte, ob er nicht Lust hätte, den nächsten Bond zu vermasseln. Zum Glück hatte er Lust. Dabei stand Gilberts Arbeit mit dem frustrierten Bondstar Sean Connery 1967 unter einem denkbar schlechten Stern. Mit Roger Moore als Bond fand er sein Alter Ego.
„One life for yourself and one for your dreams“ lautete eine Zeile aus dem Titellied von Nancy Sinatra für seinen ersten Bondfilm. So lässt sich auch Gilberts Bondschaffen auf eine Formel bringen. Zusammen mit dem genialen Setdesigner Ken Adam setzte er wie kein anderer in der Bondserie Traumwelten in Szene, die den Zuschauer die oft nicht nur schöne Wirklichkeit vergessen ließen. Eskapismus in seiner schönsten Substanz.
Märchenbonds für die Ewigkeit.
Denn Menschen, die mit Kinderaugen die Welt in ihrer ursprünglichen und unmittelbaren Schönheit sehen wollen, sterben nie aus.
Dagegen ist das Leben des Einzelnen endlich.
Am 23. Februar 2018 ist Lewis Gilbert im biblischen Alter von 97 Jahren gestorben.
Er wird unter den Bond-Fans unvergessen bleiben.
Quellen:
Lewis Gilbert, All my flashbacks – Sixty years a Film director, London 2010.
Roger Moore, Die Autobiografie – Mein Name ist Bond, James Bond, Berlin 2009.
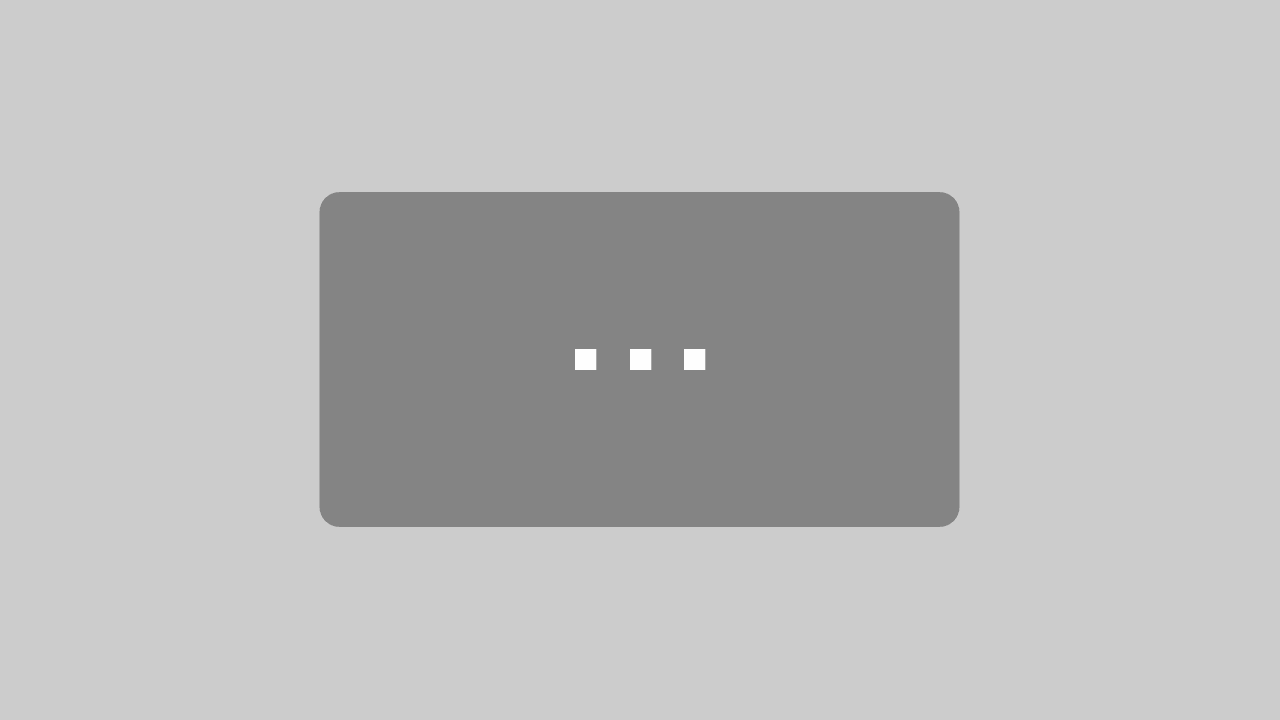









Schreibe einen Kommentar